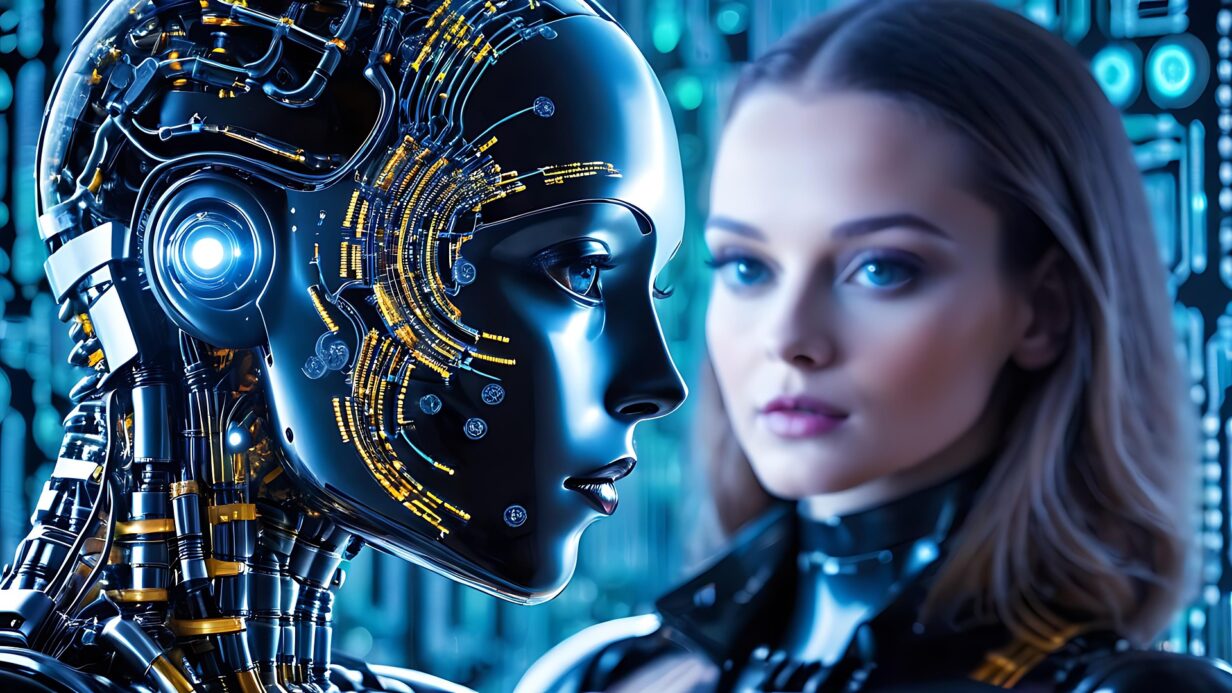
Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen junger Hochschulabsolventen und der Realität beim Berufseinstieg, klafft in den USA immer weiter auseinander. Die vom »US Bureau of Labor Statistics« veröffentlichten Zahlen zeigen, wie schwer es für junge Absolventen inzwischen ist, einen Job zu finden.
Wie »The Atlantic« berichtet, ist die Ursache für diesen Wandel vermutlich eine Kombination mehrerer Faktoren – darunter das Aufkommen generativer KI, die bereits begonnen hat, junge Arbeitnehmer schrittweise durch Algorithmen zu ersetzen. Darüber hinaus scheint ein Hochschulabschluss nicht mehr den gleichen Wettbewerbsvorteil zu bieten wie noch vor 15 Jahren.
»Wenn man gründlich darüber nachdenkt, was generative KI zu leisten vermag und welche Jobs sie ersetzen kann, dann sind es häufig die Bürotätigkeiten, für die junge Hochschulabsolventen bislang angeworben wurden«, sagte der Harvard-Ökonom David Deming dem Magazin. »Sie lesen und verarbeiten Informationen sowie Daten; sie erstellen Berichte und Präsentationen.«
Die globale Unternehmensberatung McKinsey prognostiziert, dass bis 2030 rund 30 Prozent der derzeitigen US-Arbeitsplätze automatisiert werden könnten. Goldman Sachs schätzt, dass diese Zahl bis 2045 auf 50 Prozent steigen könnte. Viele Fachleute bleiben jedoch skeptisch, was einen drohenden Arbeitsplatzverlust durch KI angeht. Wie »The Atlantic« betont, fehlen bislang Daten, die diese Hypothesen stützen.
So lang wollte das US-amerikanische Lehrtechnologie-Unternehmen Duolingo nicht mehr warten, und begann im Rahmen seiner »AI-First«-Politik damit, externe und freie Mitarbeiter durch KI zu ersetzen. In einer an alle Mitarbeiter gerichteten E-Mail, die später auf LinkedIn veröffentlicht wurde, kündigte Duolingo-CEO Luis von Ahn an, dass das Unternehmen »schrittweise aufhören werde, Auftragnehmer für Arbeiten einzusetzen, die auch von KI erledigt werden können«. Ein Teil dieser Umstellung, schrieb von Ahn, werde darin bestehen, die Technologie einzusetzen, auch wenn sie noch nicht »hundert Prozent perfekt« sei.
»Wir werden nicht alles über Nacht neu aufbauen, und für manche Dinge – wie zum Beispiel das Verstehen unserer Codebasis durch KI – werden wir Zeit brauchen«, schrieb der CEO. »Jedoch können wir nicht warten, bis die Technologie zu Hundertprozent perfekt ist. Wir wollen lieber mit Hochdruck vorgehen und gelegentlich kleine Qualitätseinbußen hinnehmen, als zu langsam zu arbeiten und dabei den richtigen Moment zu verpassen.«
Neben der »schrittweisen« Entlassung aller menschlichen Vertragspartner wird Duolingo gemäß von Ahns Zeitplan auch bei der Einstellung von Mitarbeitern sowie bei Leistungsbeurteilungen auf KI-Kenntnisse zurückgreifen.
Allerdings gießt die Wirklichkeit den Tech-Enthusiasten manchmal noch etwas Wasser in den Wein. Beispiel hierfür ist ein kürzlich von Forschern der Carnegie Mellon University durchgeführtes Experiment. Eine von ihnen entwickelte virtuelle Simulation imitierte die Strukturen eines kleinen Softwareunternehmens namens »The Agent Company« mit internen Websites, einem Slack-ähnlichen Chat-Programm, einem Mitarbeiterhandbuch und speziellen Bots – einem Personalmanager und einem Technologiechef –, die bei Fragen kontaktiert werden konnten.
Um dies zu testen, beauftragten die Forscher KI-Modelle von Google, OpenAI, Anthropic und Meta mit der Bearbeitung von Aufgaben, die ansonsten ein realer (menschlicher) Mitarbeiter in Bereichen wie Finanzen, Verwaltung und Softwareentwicklung übernimmt. Die Ergebnisse waren eher ernüchternd: Das leistungsstärkste Modell, Anthropics Claude 3.5 Sonnet, erledigte knapp ein Viertel aller Aufgaben. Die übrigen, darunter Googles Gemini 2.0 Flash und das System, das ChatGPT zugrunde liegt, beherrschten etwa zehn Prozent der gestellten Aufgaben.
Die Ergebnisse sowie andere aktuelle Forschungsergebnisse zu KI-Agenten erschweren die Annahme, dass KI-Agenten bald verfügbar sein werden – es gibt viele Aufgaben, für die sie einfach noch nicht gut genug sind. Die Studie bietet jedoch einen Einblick, wie KI-Agenten die Arbeitswelt revolutionieren könnten.
Top-Risikokapitalgeber sagt, dass KI so ziemlich alle Jobs ersetzen könnte. AuĂźer seinem eigenen …
Dass hier noch viel mehr Potenzial vorhanden ist, davon ist jedenfalls der Milliardär Marc Andreessen überzeugt, Mitgründer der kalifornischen Wagniskapitalfirma »Andreessen Horowitz«. Er malt sich eine Zukunft aus, in der alle Arbeitnehmer weltweit arbeitslos werden und es zu einer Beschäftigungsapokalypse kommt, die praktisch jeden treffen wird, außer ihn selbst und seine Milliardärs-Kollegen – als einzigartige »Genies«.
In einem Podcast seines Unternehmens »a16z« argumentierte Andreessen, dass Risikokapitalgeber – wie er und seine reichen Kumpels – zu den Einzigen zählen, die von der KI-Revolution verschont bleiben werden. Seine Firma, Andreessen Horowitz, kündigte kürzlich die Auflegung eines 20 Milliarden Dollar schweren Megafonds für KI-Startups an, dem größten Risikokapitalfonds der Geschichte.
Der milliardenschwere Investor zeichnet ein düsteres Bild vom Leben nach der Machtübernahme durch KI. Düster auch deshalb, da Andreessen ein entschiedener Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens ist – der Idee, dass jeder in der Gesellschaft auch nach der Wegrationalisierung seines Arbeitsplatzes ein würdiges Leben verdient hätte.
»Wir glauben, ein universelles Grundeinkommen würde Menschen in Zootiere verwandeln, die vom Staat gezüchtet werden«, schreibt Andreessen. »Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, bewirtschaftet zu werden; er soll nützlich, produktiv und stolz sein.«
Sollte es tatsächlich zur »KI-Übernahme« kommen, ist es indessen schwer vorstellbar, dass solche Jobs wie der von Andreessen verschont blieben. Letztendlich bewertet er lediglich die finanziellen Aussichten verschiedener Startup-Modelle. Das ist zwar keine leichte Aufgabe, aber weit entfernt von anstrengenden Berufen wie Krankenpfleger und Holzfäller oder von anspruchsvollen intellektuellen Tätigkeiten wie Wissenschaftler oder Lehrer.
Andreessens ausgesprochen egoistische Einstellung findet leider unter Technokapitalisten und politischen Experten großen Anklang. Sein berüchtigtes Werk, das »Techno-Optimist Manifesto« (Manifest des Techno-Optimisten), legt offen dar, wer von seiner KI-Revolution profitiert: »Wir glauben, dass die Technokapitalmaschine der Märkte und Innovationen nie stillsteht, sondern sich kontinuierlich nach oben dreht.«
© ÆON-Z Thinktank/Infodienst Futurmedia. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.

