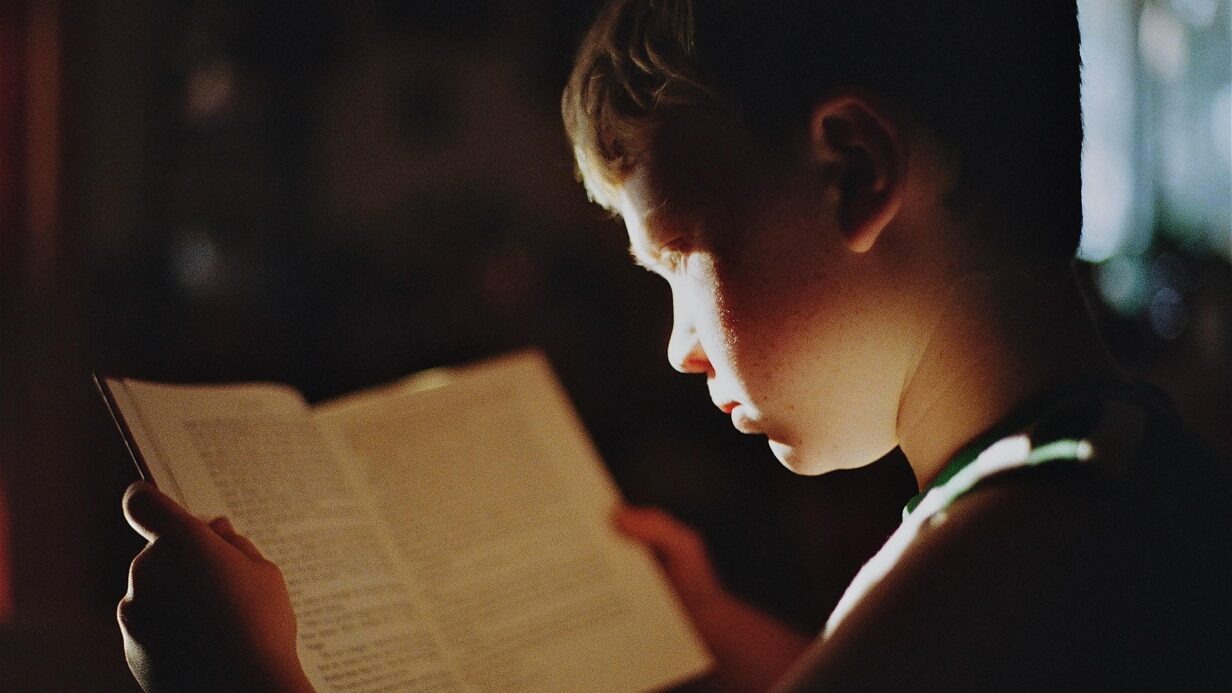
Lesekrise wird Bildungskrise
Studien wie die PISA-Studie 2022 und die IGLU-Studie 2021 zeichnen ein alarmierendes Bild des Bildungsverfalls, besonders bei der Lesekompetenz. Beide Untersuchungen belegen, dass die Leistungen kontinuierlich sinken und Deutschland in den Kernkompetenzen nur noch im OECD-Durchschnitt liegt. Ein erschreckender Befund ist, dass jedes vierte Kind in der vierten Klasse nicht den Mindeststandard beim Lesen erreicht, der für eine erfolgreiche Schullaufbahn notwendig ist. Auch bei den 15-Jährigen scheitern 25 Prozent an den Grundanforderungen im Leseverständnis. Dieser negative Trend, der sich bereits vor der Corona-Pandemie abzeichnete und durch sie noch verstärkt wurde, ist eine ernsthafte Bedrohung für die zukünftige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.
Diese Defizite beschränken sich nicht auf das Verstehen einfacher Texte, sondern zeigen sich auch in der schwindenden Lesemotivation und der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen. Ein Bildungsabbruch auf breiter Ebene ist daher nicht nur eine Hypothese, sondern eine reale Gefahr, die unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt.
Was Hänschen nicht lernt …
Noch deutlicher wird dies angesichts einer Herausforderung, die weit über einzelne PISA-Ergebnistabellen hinausgeht: Die Lesekompetenz unter Erwachsenen spaltet das Land in jene, die lesen und kritisch denken können – und Millionen, für die selbst alltägliche Texte ein Rätsel bleiben. Laut der OECD-Studie PIAAC 2023 verfügen rund 20 bis 22 Prozent der Bevölkerung – das entspricht etwa 13 Millionen Menschen – lediglich über Grundkenntnisse auf der niedrigsten Stufe der Lesekompetenz. Sie können etwa Notizen oder Fahrpläne entziffern, sind aber bei komplexeren Inhalten überfordert. Diese Kluft gefährdet autonome Teilhabe nicht nur im Berufsleben, sondern auch in Demokratie und Digitalgesellschaft.
Die OECD-Studie PIAAC unterscheidet folgende Kompetenzstufen:
- Stufe I: Diese unterste Kompetenzstufe reicht von einfachsten Lesefähigkeiten, wie das Erkennen einzelner Wörter – Verständnis für zusammenhängende Inhalte fehlt – bis zu Grundkenntnissen, etwa das Entziffern einfacher Notizen oder Fahrpläne, ohne komplexe Textinterpretation.
- Stufe II: Routineaufgaben mit klaren Informationen, beispielsweise Fakten aus einfachen Texten herausfiltern.
- Stufe III: Die Fähigkeit, mehrere Informationen zu kombinieren, einfache Argumentationsmuster zu erkennen und Texte kritisch zu bewerten.
- Stufe IV/V: Hohe Kompetenz, gekennzeichnet durch das Analysieren, Abstrahieren und Vergleichen komplexer Inhalte, verbunden mit eigenständigem, kritisch reflektierendem Denken.
Im Schnitt erzielen Deutsche 266 Punkte im Lesekompetenz-Test (OECD-Mittel: 260 Punkte). Über 60 Prozent bewegen sich auf den mittleren Stufen II und III, können also Fakten und Routineaufgaben bewältigen, aber komplexe Textarbeit fällt schwer. Ein überdurchschnittlicher Anteil erreicht die höchsten Stufen IV/V, doch gerade Menschen mit Hauptschulabschluss bleiben in großer Mehrheit (67 Prozent) auf den niedrigsten Kompetenzstufen zurück. Besonders gravierend ist die Lage bei Zugewanderten: 56 Prozent verbleiben auf Stufe I (oder darunter), ihr Kompetenzrückstand gegenüber Einheimischen beträgt im Schnitt 70 Punkte (OECD: 40 Punkte).
Bildung, Kompetenz und berufliche Teilhabe
Diese gesellschaftliche Kluft hat weitreichende Folgen: Nicht nur der Zugang zu qualifizierten Arbeitsstellen ist flankiert von Lesekompetenz – Erwerbstätige erzielen durchschnittlich 35 Punkte mehr als Erwerbslose; bei Nichterwerbstätigen im Haupterwerbsalter bleibt die Hälfte sogar auf den niedrigsten Stufen. Akademische Bildung hebt die Kompetenz deutlich, während bei Hauptschulabsolventen oft die Mehrheit auf Stufe I verharrt, selbst wenn sie nicht zugewandert sind. Diese Zahlen sind keine Randnotiz, sondern markieren eine zentrale Herausforderung für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.
Lesekompetenz als Demokratiekompetenz
Lesen ist mehr als eine Technik; es ist die Grundlage für Urteilsvermögen, kritische Eigenständigkeit und den Schutz vor Manipulation. Wer Texte kritisch lesen, Phrasen erkennen und Nuancen verstehen kann, bleibt widerstandsfähig gegenüber Populismus und Fake News – Lesekompetenz ist damit Grundvoraussetzung für selbstbestimmte Bürger und eine funktionierende Demokratie.
KI und das Paradox der Vereinfachung
Mit der Verbreitung künstlicher Intelligenz und automatisierter Textzusammenfassungen verschärft sich die Lesekluft: Wer die Schwelle zur Stufe III nicht erreicht, profitiert kaum von digitalen Helfern – vielmehr wächst die Gefahr der Manipulation. Je mehr KI das Verstehen erleichtert, desto wichtiger wird kritisches Lesen für die Bewertung digitaler Informationsströme und den Erhalt von Teilhabe und Demokratie.
Lesekompetenz bleibt der Schlüssel – für berufliche Chancen, gesellschaftliche Mitsprache und die eigenständige Erschließung auch komplexer Zusammenhänge. Die Aufgabe für Bildung und Gesellschaft: Diese Ressource gerecht zu verteilen, damit sich der Spalt zwischen den Lesenden und den Ausgeschlossenen nicht weiter vertieft.
© ›Infodienst futūrum. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.

